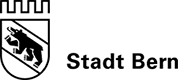Schwammstadt kurz erklärt
Das Prinzip der Schwammstadt, auch Sponge-City genannt, geht die Herausforderungen von Hitze und Starkregen gleichermassen an.
Die Umgebung wird so gestaltet, dass sie überschüssiges Wasser wie ein Schwamm vor Ort speichern kann, um dieses bei Hitze wieder abzugeben. Die Verdunstung über den Boden und durch die Vegetation kühlt die Umgebung, was das Stadtklima verbessert. Indem das Wasser vor Ort versickert, wird die Kanalisation bei Starkregen entlastet und Überschwemmungen werden verhindert.
Die Vorteile einer Schwammstadt sind
- Wasserreservoir: Gespeichertes Wasser ist auch in Trockenzeiten verfügbar für Pflanzen, Bäume und Grünflächen.
- Kühleffekt: die langsame Verdunstung des Wassers durch Pflanzen wirkt wie eine natürliche Klimaanlage und hat dadurch einen positiven Effekt auf unser Stadtklima.
- Schutz: Versickerung und Verdunstung reduzieren den oberirdischen Abfluss und entlasten die Abwasseranlagen. Dadurch werden Risiken und Schäden durch Oberflächenabfluss und Hochwasser gedämmt.
- Grundwasser: Das Regenwasser wird durch den Boden gereinigt und reichert das Grundwasser an.
- Gesundheit und Biodiversität: Die blau-grünen Elemente einer Schwammstadt erhöhen die Lebensqualität für die Bevölkerung und fördern die Biodiversität.
Bei hohen Niederschlägen entsteht ein Überangebot und das Wasser wird dort gespeichert, wo es anfällt. Bei einem Minderangebot während Trockenperioden wird das Wasser langsam wieder abgegeben. So kann ein natürlicher Regenwasserkreislauf wiederhergestellt werden und das Wasser bleibt in der Stadt verfügbar.
Herkunft: Sponge City in China
Im Jahr 2000 hat der chinesische Architekt Kongijan Yu erstmals die Idee einer «Sponge City» entwickelt. Das Konzept wurde in den nächsten Jahren in China umgesetzt, um den zunehmenden Überschwemmungen und der Staunässe in chinesischen Städten entgegenzuwirken. China hat bis heute die grösste Anzahl an Sponge Cities. Weltweit haben andere Städte aber ähnliche Konzept entwickelt:
- In Europa haben die Städte Stockholm, Wien, Berlin und Lyon als erste begonnen, die Vision der Schwammstadt in die Praxis umzusetzen. Kopenhagen entwickelte 2012 den Wolkenbruchplan, um die Stadt vor Hochwasser bei Starkregenereignissen zu schützen.
- In Städten wie Melbourne, Australien, ist der Umgang mit Hitze und Wasserknappheit schon länger ein Thema. Es wird dort von wassersensibler Stadtplanung gesprochen.
- In den USA setzen Städte wie New York und Philadelphia auf blau-grüne Infrastruktur, um Überflutungen in den Griff zu bekommen.
Blau-grüne Schwammstadt
Die Elemente einer Schwammstadt setzen sich vor allem aus blau-grüner Infrastruktur zusammen. Sie dienen der Versickerung, dem Rückhalt, der Speicherung, der Reinigung, der Nutzung und der Ableitung von Regenwasser.
- Grüne Infrastruktur: Bäume, Grünflächen, Pärke, Feuchtgebiete, begrünte Fassaden und Dächer
- Versickerung: Durchlässige Oberflächen (Grünflächen, Chaussierungen, Ruderalflächen, Rasenliner, ungebundene Pflästerungen, Sickerasphalt u.v.m.), Versickerungsmulden, -flächen und -beete
- Reinigung: Retentionsfilter, Filterrinnen, Filterbeete
- Regenwasserspeicherung: Zisternen, Rigolen, Rückhaltebecken, Retentionsflächen
- Offene Wasserflächen: Teiche, Seen, fliessendes Wasser
- Dezentrales Regenwassermanagement