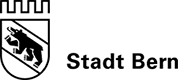Literarische Auszeichnungen 2024
Christina Frosio, Dimitri Grünig und Meral Kureyshi werden mit dem Stipendium Weiterschreiben ausgezeichnet. Der Spezialpreis Vermittlung geht an das Kollektiv Kitzeln.
Die Preisverleihung fand am Mittwoch, 13. November 2024 im Skelett-Saal des Naturhistorischen Museum Bern statt.
Laudatio Christina Frosio
Christina Frosios Erzählungen sind alle real. Sie sind genauso passiert. Es kann nicht anders sein. Denn so steht es in ihren Texten. Da steht alles, nichts zu viel und nichts zu wenig, vor allem nichts Überflüssiges. Da stehen diese Sätze, welche nicht zweimal gelesen werden müssen, welche kurz, knapp und klar sind. Zu Beginn überliest mensch diese Sprache beinahe, so leicht und unaufdringlich kommt sie daher. Mit fortschreitender Lektüre folgt dann die Überraschung. Diese «kleinen» Sätze eröffnen rasch grössere Gesamtbilder, welche uns Lesende durch den Text begleiten und uns noch lange beschäftigen.
Die Erzählungen an sich sind, sollten sie inhaltlich zusammengefasst werden, weder besonders extravagant, noch aussergewöhnlich. Da werden keine grossen Spannungsbögen konstruiert, die Pointen beinahe unmerklich gesetzt. Die Inhalte der Erzählungen sind wie ihre Figuren sehr unterschiedlich, ihre Geschichten vielfältig.
Da haben wir zum Beispiel Madeleine aus dem ersten Buch von Christina Frosio «Noch ist nicht Herbst», welches 2014 im Offizin Verlage erschienen ist. Madeleine ist mit dem mehr als 10 Jahre älteren Peter verheiratet, hat mit ihm die zwölfjährige Tochter Lisa und lässt andere über ihr Leben entscheiden. Vermeintliche Zuflucht bietet ihr die Macht über ihren Körper, es ist quasi der letzte Ort, wo sie Kontrolle in ihrem Leben übernimmt. So isst sie teilweise nichts oder kaum oder erbricht sich wieder. Sie verliebt sich in den bereits erwachsenen Sohn ihres Mannes, Fred, verliebt sich das erste Mal in ihrem Leben, ändert sich selber nicht und doch wird vieles anders.
Da haben wir im zweiten Buch der Autorin «Salamanderbeine», welches 2023 im Herausgeber Verlag erschienen ist und aus zwölf Erzählungen besteht, zum Beispiel folgende Figuren: der durch Australien reisende Gärtner Reto, die alt gewordene Iris, der Jugendliche Fabio, der einen Sommerferienjob als Winzer hat, da sind ein Kind, der erste Kuss, Elisabetta, junge, ältere Menschen, Eliza, Benjamin. Die Erzählungen, in denen sie vorkommen, sind mal kürzer, mal länger. Vielleicht handelt es sich dabei um von der Autorin selbst Erlebtes, Beobachtetes, Gehörtes, oder Erdachtes. Sie sind inhaltlich oft lose oder durch nichts miteinander verbunden – durch nichts anderes als durch die Sprache, in welcher sie geschrieben sind. Sie sind miteinander verbunden durch den Blick der Autorin, welchen sie auf die Figuren und ihre Geschichten richtet. Es ist dieser wache, dieser andere Blick, den Christina Frosio hat und der sich einerseits bescheiden, andererseits glasklar vom Durchschnitt abhebt. Christina Frosio vermag es, ihre Wahrnehmung, ihr Hören und Sehen in Sprache umzuwandeln. Sie tut dies äusserst sorgfältig und präzise. So überzeugt sie mit ihren Erzählungen, gibt ihnen Substanz und kreiert ganze Beziehungswelten anhand alltäglicher Situationen.
Die Autorin war für einige von uns eine wahre Neuentdeckung. Und da sich beim Lesen in diesen kleinen Bildern immer grössere eröffneten, regte sich auch bei uns der Gedanke: Da liegt noch mehr drin! Mit dem Stipendium Weiterschreiben möchten wir die Autorin dazu ermutigen, weitere, vielleicht auch grösere Schritte zu wagen. Wir sind gespannt und gratulieren Christina Frosio herzlich zum Weiterschreiben.
Laudation für Dimitri Grünig
«Im religiösen, konservativen Elternhaus, in dem ich aufgewachsen bin, war die Sexualität ganz allgemein ein rotes Tuch. Wenn schon das Sprechen über Körperlichkeit zwischen Männern und Frauen tabu ist, wird es bei allem anderen erst recht schwierig.» – diese Zeilen stehen auf Seite 51, unter einer Zeichnung von einem Geschicklichkeitsspiel auf dem Schulhausplatz in Goldiwil. Das Spiel, gebaut aus soliden Holzbalken, an dem Ketten hängen, an denen wiederum kleinere Holzstücke befestigt sind, die miteinander verbunden, aneinander gereiht und wieder mit Ketten verbunden sind, steht in fast leerer Landschaft. Weiter hinten sind Bäume zu sehen, eigentlich nur Äste ohne Blätter. Es ist wohl Winter. Schwierig ist es, sich vorzustellen, dass hier Kinder spielen, so leer und kalt wirkt die Zeichnung.
Der Künstler und Illustrator Dimitri Grünig erzählt uns in «Aber schwul bin ich immer noch» die Geschichte eines jungen Mannes, der in einem einengenden religiösen Umfeld im Berner Oberland gross wird und mit seiner Homosexualität hadert. Er versucht sie wegzubeten, zu verdrängen und beginnt schliesslich ein Therapieprogramm, das ihn «heilen» soll. Für dieses, sein erstes Buch, hat Dimitri Grünig ganz viele Gespräche mit Betroffenen solcher sogenannter Konversionstherapien geführt. Die Gespräche hat er aufgezeichnet und transkribiert. Für die Erzählung kreierte er einen fiktionalisierten Charakter, der viele Stimmen in sich vereint und der so für das Erleben und das Leid vieler steht.
Es wäre ein Leichtes, die Geschichte schnell durchzulesen. Auf jeder Seite sind es nur wenige Zeilen Text. Das Buch ist schmal. Doch wer dieses Buch in einem Rutsch durchliest, wird dem Werk alles andere als gerecht.
Es ist eine Art literarische Reportage und gleichzeitig eine genaue und kondensierte Erzählung. Die Geschichte erschliesst sich auf zwei Ebenen: Während der Text die Umstände klar benennt, sind die Illustrationen subtiler. Sie fangen Stimmungen ein, zeugen von Leere, Einsamkeit und Abgeschiedenheit. Dimitri Grünig hat diese Bilder unterwegs gezeichnet, auf dem Weg zu den Gesprächspartnern – oder nachher, auf dem Heimweg. Sie bilden reale Orte ab: eindrückliche
Berggegenden, einsame Ecken im hintersten Kiental, aber auch umgestürzte Bäume, ein geparkter Viehtransporter, Bahnübergänge, Kirchenfenster und Kirchenbänke. Oder auch das eingangs erwähnte Geschicklichkeitsspiel. Diese Bleistiftskizzen lösen bei den Leser*innen beklemmende Gefühle aus.
Eine grosse Stärke des Buches ist die Tatsache, dass die Erzählung – ganz anders als die Bilder – nicht schwarzweiss ist. Sie schafft Leerstellen und scheinbare Widersprüchlichkeiten, die es auszuhalten gilt. Der Protagonist sagt an einer Stelle, er habe diese unfassbar schwierige Zeit nur überlebt, weil er Halt in seinem Glauben gefunden hat. Gleichzeitig war es ja die Kirche und ihr Umgang mit der Homosexualität, die überhaupt dazu geführt hat, dass er sich in dieser Situation
wiederfand.
Trotz der Schwere des Themas ist der Text nicht anklagend. Grund dazu gäbe es: Im Nachwort erfahren wir, dass sogenannte Konversionsmassnahmen in der Schweiz noch nicht verboten sind.
Mit «Aber schwul bin ich immer noch» zeigt sich Dimitri Grünig als genauer Beobachter und sorgfältiger und empathischer Erzähler. Wie er Text und Bilder zu einer stimmigen und eindringlichen Erzählung zusammenbringt, hat uns begeistert – und wir gratulieren ihm sehr herzlich zum Weiterschreiben Stipendium der Stadt Bern!
Laudatio für Meral Kureyshi
Das Buch «Fünf Jahreszeiten» erzählt von einer jungen Frau, die im Kunstmuseum als Aufsicht arbeitet, um die Schulden ihres verstorbenen Vaters abzuzahlen. Sie hat einen Freund, ist aber in einen anderen verliebt. Sie will sich nicht entscheiden, lässt sich durch ihr Leben treiben, bis es mit beiden aus ist.
Das ganze Buch hindurch sieht man die beiden Männer damit hadern, dass der andere auch da ist. Die Protagonistin hingegen scheint ganz in der Gegenwart aufzugehen, sie lässt sich nicht unter Zugzwang setzen. Sie macht das auf eine derart nonchalante Art und Weise, dass wir als Lesende, welche in einer Gesellschaft leben, die Gegenwärtigkeit als erstrebenswertes Gut verkündet, schon fast neidisch sein könnten. Doch nur fast, denn das Abwarten birgt auch eine Bedrohung: Es droht, zum Erstarren zu führen.
Es ist Kureyshis Sprache, die uns durch dieses Buch trägt. Die Protagonistin scheint keineswegs aus Gefühlskälte oder zeitgenössischer Abgeklärtheit wie in Allegro Pastel von Leif Randt zu handeln. Ihre sensible Wahrnehmung der Welt bringt uns als Lesende gleichzeitig in einen Schwebezustand und einen Sog. Das Buch hat einen Wirklichkeitseffekt, der an L’Étranger von Camus erinnert und sich daraus speist, dass bei Kureyshi Zeitgeistdiagnose Form wird.
Durch genaues Hinsehen hinterfragt sie die gängigen Floskeln und Schablonenhaftigkeiten, mit denen wir unsere Alltäglichkeit zu beschreiben versuchen. Ihre Beschreibungen bringen uns in eine haptisch spürbare Gegenwart und erzeugen einen poetischen Effekt. So wird der Liebhaber beispielsweise beim Versuch beschrieben, den Stein so zu werfen, dass er möglichst oft übers Wasser hüpft, anstatt seine Handlung mit dem gängigen Wort «schiefern» zu beschreiben. Dadurch zeigt sich die Verspieltheit und Ausgelassenheit, die diesem Moment anhaftet, den die beiden Protagonisten miteinander verbringen.
«Ich wollte festhalten, was das Auge nie zu sehen vermag, den Stillstand, zählte die grauen Plastiknoppen am Boden des Bahnhofs bis zu der Holzskulptur von Christophorus, er wurde aus dem Heiligenkalender gestrichen. Lange dachte ich, dass es Jesus sei.» (S. 111, Fünf Jahreszeiten, Meral Kureyshi, 2019, Limmat Verlag)
Wir folgen der Hauptfigur durch die Anatomie ihres assoziativen Denkens, das von sinnlichen Eindrücken und präzisen Beobachtungen durchkreuzt ist und uns in den Kureyshi Kosmos hinein hebt. Nicht selten bringt uns das Buch zum Schmunzeln durch die Lakonie und Beherrschtheit, mit der die Figuren miteinander kommunizieren.
«Darf ich heute bei dir schlafen?», frage ich.
«Aber nur weil du mir leid tust», sagt Nikola, der vor mir einschläft und mich anfurzt.
Ich halte die Luft an.
(S. 149, Fünf Jahreszeiten, Meral Kureyshi, 2019, Limmat Verlag)
Ebenso amüsant ist die sympathische Dreistigkeit der Protagonistin, wenn sie im Aufenthaltsraum des Museums einen einsamen Müsliriegel vom Tisch stiehlt und die Verpackung so im Müll drapiert, dass sie nicht gesehen werden kann.
2017 hat Meral Kureyshi bereits das Weiterschreiben Stipendium nach der Veröffentlichung ihres Debütromans «Elefanten im Garten» erhalten, das damals von der Literaturkommission verliehen wurde. Der Roman wurde von der Kritik als neue Stimme im Genre der Migrationsromane gefeiert.
Die neue interdisziplinäre Kulturkommission würdigt Meral Kureyshi für ihr vielschichtiges sprachliches Können und ihren Anspruch, sich nicht auf ein Genre festlegen zu lassen, wie der zweite Roman, Fünf Jahreszeiten, beweist. Die Jury ist gespannt, in welche Richtung sich der poetische und eindringliche Kureyshi Kosmos erweitern wird und freut sich ausserordentlich, ihrer Berner Autorin das Weiterschreiben Stipendium zum zweiten Mal zu verleihen.
Wir gratulieren Meral Kureyshi von Herzen zum Weiterschreiben-Stipendium 2024.
Laudatio für Kollektiv Kitzeln, Spezialpreis Vermittlung
Mit grosser Freude verleiht die Jury den Spezialpreis Vermittlung an das Kollektiv Kitzeln. Das Kollektiv – bestehend aus den vier Autorinnen Sarah Altenaichinger, Lea Schlenker, Mia Ackermann und Fine Degen – hat sich zum Ziel gesetzt, die Literaturszene mit neuen Perspektiven und einer besonderen Offenheit für Vielfalt und Austausch zu bereichern. Ihnen ist es gelungen, eine neue Bühne zu schaffen, auf der ein breites Spektrum an künstlerischen Darbietungen ihren Platz findet.
Kollektiv Kitzeln ist jedoch viel mehr als eine Lesebühne. Die Veranstaltungen, die in der Stauffacher-Buchhandlung stattfinden, öffnen die Tür zu einem breiten Spektrum an Themen und künstlerischen Ausdrucksformen, die von Literatur und Poesie bis hin zu Musik reichen. Was diese Gruppe besonders auszeichnet, ist ihr Engagement für feministische und inklusive Themen, ohne dabei ausschliesslich auf diese Aspekte begrenzt zu sein. Sie schaffen eine Bühne, die nicht in einer Nische verweilt, sondern bewusst ein breites Publikum anspricht.
Hinter diesem Konzept steht eine klare Vision, die mit einem bemerkenswerten Feingefühl umgesetzt wird. Das Kollektiv beeindruckt durch Professionalität und einen unaufdringlichen Stil, der ihren Fokus auf Vielfalt und Vermittlung deutlich spürbar macht. Besonders hervorzuheben ist das Engagement des Kollektivs für FINTA-Personen – also Frauen, intergeschlechtliche, nicht-binäre, trans und agender Personen. Die Mitglieder des Kollektivs Kitzeln stellen mit ihrer Plattform sicher, dass auch die Stimmen und Perspektiven dieser oft unterrepräsentierten Gruppen auf die Bühne kommen und damit mehr Sichtbarkeit erhalten. In einer Literaturszene, die häufig von cis-männlichen Künstlern dominiert wird, bietet das Kollektiv Kitzeln bewusst eine Alternative.
Ein weiteres Merkmal der Arbeit von Kollektiv Kitzeln ist der breit angelegte Themenfokus. Auch wenn das Kollektiv feministische Inhalte und Fragen der Gleichberechtigung betont, schränkt es sich nicht auf diese Themen ein. Vielmehr geht es darum, eine Vielfalt an Inhalten zu präsentieren, ohne die auftretenden Künstler*innen allein auf ihre Identität zu reduzieren. Diese Offenheit und das klare Konzept der Veranstaltungen schaffen Raum für ein breites Publikum, was die Wirkung und Reichweite des Kollektivs zusätzlich verstärkt.
Das Kollektiv bleibt oft im Hintergrund, während es den Raum für ihre Gäste öffnet und gestaltet und durch diese Auszeichnung soll Ihre Arbeit die verdiente Anerkennung finden. Mit dem Spezialpreis Vermittlung möchten wir das Kollektiv Kitzeln würdigen, weil es mit seiner Arbeit neue Möglichkeiten schafft, künstlerische Ausdrucksformen zu erleben und Vielfalt sichtbar zu machen. Die Mitglieder des Kollektivs leisten einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Landschaft der Stadt Bern und beweisen, dass Literatur und Kunst Menschen zusammenbringen und zum Nachdenken anregen können.
Wir gratulieren dem Kollektiv Kitzeln zu dieser Auszeichnung und bedanken uns für ihr Engagement und ihren Einsatz und freuen uns in Zukunft mehr von Ihnen zu hören.