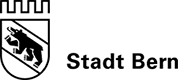Formen von Behinderungen
Auf dieser Seite erfahren Sie mehr über die verschiedenen sichtbaren und unsichtbaren Formen von Behinderungen.
Die Formen von Behinderungen sind sehr vielfältig. Manche sind sichtbar. Ein grosser Teil der Behinderungen ist jedoch unsichtbar. Unsichtbare Behinderungen werden vom Umfeld oft nicht wahrgenommen, weil kein äusseres Merkmal auf die Behinderung hinweist. Die Behinderungen sind deshalb aber nicht weniger einschränkend. Oft werden die folgenden Formen von Behinderungen unterschieden:
Kognitive Beeinträchtigungen
Zu den kognitiven Beeinträchtigungen zählen zum Beispiel Schwierigkeiten beim Lernen, Planen, Einordnen oder Argumentieren. Bei den Betroffenen verläuft insbesondere die Entwicklung im Kindesalter langsamer und anders als bei anderen Menschen, dadurch können die Entwicklungsschritte weniger gut vorausgesagt werden. Die Begriffe «geistig» und «seelisch» implizieren eine spirituelle Komponente. Das Wort «Behinderungen» empfinden Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen oft negativ. Viele machten die Erfahrung, dass dieser Begriff als Beleidigung gemeint war.
Barrieren im Alltag
- Anspruchsvoll formulierte Texte
- Fehlende Leichte Sprache
- Fehlende Unterstützung bei der Arbeit, Freizeitgestaltung und Haushaltsführung
Psychische Beeinträchtigungen
Psychische Beeinträchtigungen oder Erkrankungen, welche lange andauern oder unheilbar sind, können ebenfalls eine Behinderung darstellen, wenn die Betroffenen in ihrem alltäglichen und gesellschaftlichen Leben eingeschränkt werden. Manche Menschen erleben starke Angst in bestimmten Situationen, haben Schwierigkeiten mit sozialen Interaktionen oder einen stark verminderten Antrieb. In den meisten Fällen sind psychische Behinderungen unsichtbar.
Barrieren im Alltag
- Präsenzpflicht bei Veranstaltungen oder Dienstleistungen
- Fehlende Online-Schalter
- Viele Menschen auf engem Raum
- Orte mit vielen Reizen (Geräusche, Licht usw.)
Neurodivergenz
Bei neurodivergenten Personen verarbeitet das Gehirn Informationen auf eine andere Art und Weise. Neurodivergenz kann beispielsweise bedeuten, dass die Umwelt anders wahrgenommen wird oder Reize anders gefiltert oder verarbeitet werden. Bekannte Beispiele für Neurodivergenz sind das Autismus-Spektrum, ADHS oder Legasthenie.
Barrieren im Alltag
- Orte mit vielen Reizen (Geräusche, Licht usw.)
- Komplexe soziale Situationen
- Unausgesprochene Regeln und Erwartungen
- Plötzliche Veränderungen im gewohnten Umfeld oder von Abläufen
Hörbehinderungen
Menschen mit Hörbehinderungen haben eine eingeschränkte Hörfähigkeit oder sind gehörlos. Insbesondere ältere Personen sind häufig betroffen von einer leichten bis schweren Schwerhörigkeit. Auch ein Tinnitus kann so störend sein, dass er eine Beeinträchtigung der Hörfähigkeit darstellt. Gehörlose Menschen sind nicht stumm. Viele beherrschen die Lautsprache und können sich verbal ausdrücken. Ist dies nicht der Fall, gibt es zahlreiche weitere Möglichkeiten sich mitzuteilen. Zentral für viele Menschen mit Hörbehinderungen sind Gebärdensprachen. Sie haben eine eigene Grammatik und Geschichte und entwickeln sich wie Lautsprachen weiter. Für viele gehörlose Menschen sind sie die Erstsprachen, weshalb sie wichtige Bestandteile der Identität und Kultur der Gehörlosen sind.
Barrieren im Alltag
- Akustische Informationen und Lautsprache
- Fehlende Höranlagen, Gebärdenübersetzung und Untertitel
- Anspruchsvoll formulierte Texte
Sehbehinderungen
Von Sehbehinderungen spricht man beispielsweise, wenn eine Sehschwäche nicht mit einer Brille oder Kontaktlinsen korrigiert werden kann und Informationen nur visuell erfasst werden können. Nebst verschwommenem Sehen gibt es aber auch zahlreiche weitere Formen von Sehproblemen. Es können zum Beispiel Gesichtsfeldausfälle auftreten, die Augenbewegungen nicht richtig kontrolliert werden oder das Sehvermögen stark vom Umgebungslicht abhängen. Auch blinde Menschen können einen minimalen Sehrest haben und sehen, selbst ohne Sehrest nicht immer die Farbe schwarz.
Barrieren im Alltag
- Visuelle Informationen
- Fehlende auditive oder taktile Orientierungshilfen
- Plötzliche Veränderungen der räumlichen Umgebung
- Nicht barrierefreie digitale Inhalte (Websites, Programme usw.)
Mobilitätsbehinderungen
Bei Menschen mit Mobilitätsbehinderungen liegt eine Beeinträchtigung der Beweglichkeit, der Muskelkraft oder der Steuerung von bestimmten Körperteilen vor. Die Beeinträchtigung kann von einer Gangunsicherheit oder unkontrollierbaren Bewegungen bis zur vollständigen Lähmung reichen. Zudem kann sie in Schüben auftreten und muss nicht immer gleich stark ausgeprägt sein. Auch Fehlbildungen oder fehlende Gliedmassen können Mobilitätsbehinderungen zur Folge haben. Je nach Ursache der Beeinträchtigung können weitere Körperfunktionen wie etwa die Blasenkontrolle eingeschränkt sein.
Barrieren im Alltag
- Nicht barrierefreie Infrastruktur (Treppen, schmale Durchgänge, WCs usw.)
- Geräte und Bedienelemente, deren Bedienung Beweglichkeit oder Koordination erfordern
- Arbeitsflächen, Schalter, Regale oder ähnliche, die nicht auf die Höhe sitzender Menschen ausgelegt sind
Chronische Erkrankungen
Es gibt zahlreiche chronische Erkrankungen, welche die Betroffenen dauerhaft in ihrer gesellschaftlichen Teilhabe einschränken und zu Diskriminierungen führen können.
Barrieren im Alltag
- Schmerzen und Beschwerden, welche die Teilhabe verhindern
- Fehlende Online-Angebote
- Fehlende Flexibilität, welche die Organisation des Alltags mit Krankheit erschwert