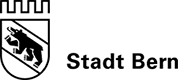Kommunikation und Behinderungen: Worauf muss ich achten?
In diesem Sprachleitfaden erhalten Sie Tipps zum Schreiben und Sprechen über Menschen mit Behinderungen.
Wozu ein Sprachleitfaden?
Unsere Sprache befindet sich in einem stetigen Wandel. Die Bedeutung und korrekte Verwendung von einzelnen Wörtern oder ganzen Redewendungen verändern sich im Lauf der Zeit. Auch der Umgang mit Menschen mit Behinderungen hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Politik, Wissenschaft und Gesellschaft waren lange Zeit der Ansicht, man tue der Gesellschaft und den Betroffenen etwas Gutes, wenn man Menschen mit Behinderungen vom Rest der Gesellschaft trennt und sie fürsorgerisch separat unterbringt. Mit der UNO-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) kam ein Paradigmenwechsel. Die Verwirklichung der Menschenrechte für Menschen mit Behinderungen steht im Zentrum. Ziel ist nicht mehr fürsorgerische Separation, sondern Inklusion. Die Schweiz hat sich 2014 mit der Ratifizierung der UN-BRK zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen verpflichtet.
Inklusion ist das Recht auf Zugehörigkeit und bedeutet, dass kein Mensch ausgeschlossen oder an den Rand gedrängt werden darf. Vielfalt wird als Norm und als Bereicherung anerkannt. Menschen mit Behinderungen haben wie alle Menschen das Recht auf Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben ohne Diskriminierung.
Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen bedeutet eine ungleiche, schlechtere Behandlung von Menschen mit Behinderungen aufgrund des Diversitätsmerkmals «Behinderung», die nicht mit sachlichen Gründen erklärt werden können.
Diskriminierung drückt sich nicht nur im direkten Verhalten gegenüber anderen aus, sondern auch in der Art, wie wir kommunizieren. Das muss nicht immer Absicht sein, sondern kann unbewusst geschehen.
Diskriminierungsfrei kommunizieren bedeutet, dass alle Menschen gleichwertig angesprochen, dargestellt und behandelt werden.
Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie mit einer diskriminierungsfreien Sprache respektvoll mit und über Menschen mit Behinderungen sprechen, Missverständnisse verhindern, Barrieren abbauen und so die Gleichstellung und Inklusion unterstützen.
Was sind Behinderungen
Gemäss UN-BRK entstehen Behinderungen aus einer Wechselwirkung von zwei Faktoren. Auf der einen Seite stehen Beeinträchtigungen. Das sind individuelle körperliche, psychische oder kognitive Funktionseinschränkungen oder Funktionsweisen, die von der Mehrheit der Bevölkerung abweichen. Beeinträchtigungen bleiben über längere Zeit bestehen und weisen eine gewisse Intensität auf. Auf der anderen Seite stehen gesellschaftliche Rahmenbedingungen und umweltbedingte Barrieren, die ein vollwertige Teilhabe und Mitbestimmung verhindern. Behinderungen bezeichnen damit die Interaktionen zwischen Beeinträchtigungen und bestehenden Barrieren. Die Barrieren und Hindernisse, auf welche Menschen mit Behinderungen in ihrem Alltag stossen, sind zahlreich. Um dies zu unterstreichen, kann man die Mehrzahl «Behinderungen» verwenden.
Als Synonym für Behinderung trifft man gelegentlich auf den Begriff «Handicap». Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verwendet den Begriff heute nicht mehr, da Handicap im englischsprachigen Raum von vielen als beleidigend empfunden wird. Dem Wort werden unterschiedliche negative Bedeutungen zugeschrieben. Unter anderem wurde Handicap früher in England bei Pferderennen verwendet. Wenn ein Pferd deutlich überlegen war, erhielt es zusätzliches Gewicht, um seinen Vorteil auszugleichen. Beim Handicap handelt es sich also um eine absichtlich auferlegte Benachteiligung. Eine Behinderung wird jedoch weder absichtlich erzeugt noch wird damit ein Vorteil ausgeglichen.
Menschen mit besonderen Bedürfnissen?
Die Bedürfnisse von Menschen sind so unterschiedlich wie ihre Persönlichkeiten und Erfahrungen. Demnach sind besondere Bedürfnisse kein Merkmal, welches nur auf Menschen mit Behinderungen zutrifft. Somit sollte diese Bezeichnung «besondere oder spezielle Bedürfnisse» nicht generell als Synonym für Menschen mit Behinderungen verwendet werden. Das Unterscheiden von Menschen mit «normalen» und «besonderen» Bedürfnissen ist nicht im Sinne einer inklusiven Gesellschaft. Dies gilt auch für Barrierefreiheit. Das Ziel ist nicht eine behindertengerechte Gestaltung, sondern Hindernisfreiheit, welche für alle Menschen Vorteile bringt.
Menschen mit Behinderungen
Die Personen, über die Sie berichten, sind Menschen mit vielen Eigenschaften, Rollen und Diversitätsmerkmalen. Behinderungen sind nur eines davon. Deshalb eignet sich der Begriff «Menschen mit Behinderungen» gut. Der Begriff «die oder der Behinderte» sollte nicht benutzt werden, da er Personen auf ihre Behinderungen reduziert.
| 🙂 | 🙁 |
| Mensch mit Behinderungen | Die/der Behinderte |
| Mensch mit Sehbehinderungen | Die/der Blinde |
| Behinderungen | Handicap, Störung |
| Menschen mit Unterstützungsbedarf, Personen mit Anrecht auf Nachteilsausgleich | Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Andersbegabte |
| Barrierefrei, hindernisfrei | Behindertengerecht, rollstuhlgerecht |
Welche Formen von Behinderungen gibt es?
Die Gruppe der Menschen mit Behinderungen ist sehr vielfältig. Manche Behinderungen sind sichtbar. Ein grosser Teil der Behinderungen ist jedoch unsichtbar. Unsichtbare Behinderungen werden vom Umfeld oft nicht wahrgenommen, weil kein äusseres Merkmal auf die Behinderung hinweist. Die Behinderungen sind deshalb aber nicht weniger einschränkend. So unterschiedlich wie die Beeinträchtigungen, sind die Bedürfnisse und die Hindernisse, auf welche Betroffene im Alltag stossen. Oft werden die folgenden Formen von Behinderungen unterschieden:
Zu den kognitiven Beeinträchtigungen zählen zum Beispiel Schwierigkeiten beim Lernen, Planen, Einordnen oder Argumentieren. Die Begriffe «geistig» und «seelisch» implizieren eine spirituelle Komponente. Bei den Betroffenen verläuft insbesondere die Entwicklung im Kindesalter langsamer und anders als bei anderen Menschen, dadurch können die Entwicklungsschritte weniger gut vorausgesagt werden.
Barrieren: Zum Beispiel anspruchsvoll formulierte Texte, fehlende Leichte Sprache
Psychische Beeinträchtigungen oder Erkrankungen, welche lange andauern oder unheilbar sind, können ebenfalls eine Behinderung darstellen, wenn die Betroffenen in ihrem alltäglichen und gesellschaftlichen Leben eingeschränkt werden. Manche Menschen erleben starke Angst in bestimmten Situationen, haben Schwierigkeiten mit sozialen Interaktionen oder einen stark verminderten Antrieb. In den meisten Fällen sind psychische Behinderungen unsichtbar.
Barrieren: Zum Beispiel Präsenzpflicht bei Veranstaltungen oder Dienstleistungen, fehlende Online-Schalter
Bei neurodivergenten Personen verarbeitet das Gehirn Informationen auf eine andere Art und Weise. Neurodivergenz kann beispielsweise bedeuten, dass die Umwelt anders wahrgenommen wird oder Reize anders gefiltert oder verarbeitet werden. Bekannte Beispiele für Neurodivergenz sind das Autismus-Spektrum, ADHS oder Legasthenie.
Barrieren: Zum Beispiel offene, laute Orte mit vielen Umgebungsreizen, komplexe soziale Situationen unausgesprochene Regeln und Erwartungen
Menschen mit Hörbehinderungen haben eine eingeschränkte Hörfähigkeit oder sind gehörlos. Insbesondere ältere Personen sind häufig betroffen von einer leichten bis schweren Schwerhörigkeit. Auch ein Tinnitus kann so störend sein, dass er eine Beeinträchtigung der Hörfähigkeit darstellt. Zentral für viele Menschen mit Hörbehinderungen sind Gebärdensprachen. Sie haben eine eigene Grammatik und Geschichte und entwickeln sich wie Lautsprachen weiter. Für viele gehörlose Menschen sind sie die Erstsprachen, weshalb sie wichtige Bestandteile der Identität und Kultur der Gehörlosen sind.
Barrieren: Zum Beispiel akustische Informationen, Lautsprache, fehlende Höranlagen, fehlende Untertitel, komplexe Texte
Von Sehbehinderungen spricht man beispielsweise, wenn eine Sehschwäche nicht mit einer Brille oder Kontaktlinsen korrigiert werden kann und Informationen nur visuell erfasst werden können. Nebst verschwommenem Sehen gibt es aber auch zahlreiche weitere Formen von Sehproblemen. Es können zum Beispiel Gesichtsfeldausfälle auftreten, die Augenbewegungen nicht richtig kontrolliert werden oder das Sehvermögen stark vom Umgebungslicht abhängen. Auch blinde Menschen können einen minimalen Sehrest haben und sehen, selbst ohne Sehrest nicht immer die Farbe schwarz.
Barriere: Zum Beispiel visuelle Informationen, Veränderungen der räumlichen Umgebung, nicht barrierefreie Websites und Programme
Bei Menschen mit Mobilitätsbehinderungen liegt eine Beeinträchtigung der Beweglichkeit, der Muskelkraft oder der Steuerung von bestimmten Körperteilen vor. Die Beeinträchtigung kann von einer Gangunsicherheit oder unkontrollierbaren Bewegungen bis zur vollständigen Lähmung reichen. Zudem kann sie in Schüben auftreten und muss nicht immer gleich stark ausgeprägt sein. Auch Fehlbildungen oder fehlende Gliedmassen können Mobilitätsbehinderungen zur Folge haben. Je nach Ursache der Beeinträchtigung können weitere Körperfunktionen wie etwa die Blasenkontrolle eingeschränkt sein.
Barrieren: Zum Beispiel Treppen, nicht barrierefreie Infrastruktur, Geräte und Automaten, deren Bedienung viel Beweglichkeit oder Koordination erfordern
Weiter gibt es zahlreiche chronische Erkrankungen, welche die Betroffenen dauerhaft in ihrer gesellschaftlichen Teilhabe einschränken und zu Diskriminierungen führen können.
Barrieren: Zum Beispiel Schmerzen und Beschwerden, welche die Teilhabe verhindern, fehlende Online-Angebote, grosser zusätzlicher Aufwand, um sich mit der Krankheit im Alltag zu arrangieren.
| 🙂 | 🙁 |
| Kognitive Behinderungen | Geistig oder seelisch behindert, beschränkt, debil |
| Gehörlos | Taub, taubstumm |
| Trisomie 21, Down-Syndrom | Mongoloid |
| Mensch mit psychischen Behinderungen | Irrer, Psychopath, Geisteskranke |
| Mensch im Autismus-Spektrum | Mensch mit Autismus-Spektrum-Störung |
| Kleinwüchsige Person | Zwerg |
Haltung
Wichtig beim Schreiben und Sprechen über Behinderungen ist eine respektvolle, wertfreie und offene Haltung. Hier folgen einige Tipps, wie dies einfacher gelingt:
- Zeigen Sie Interesse für das Leben des Gegenübers und stellen Sie Fragen. Dazu gehört auch zu respektieren, wenn jemand eine Frage nicht beantworten möchte.
- Wie Menschen mit Behinderungen bezeichnet werden möchten und sich selbst bezeichnen, ist sehr individuell. Beispielsweise lehnen viele Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen den Begriff «Behinderungen» ab, da er ihnen gegenüber beleidigend verwendet wurde. Fragen Sie Ihr Gegenüber mit Behinderungen, wie diese Person bezeichnet werden möchte. Manche Menschen verwenden klar abwertende oder diskriminierende Bezeichnungen für sich selbst. Die Gründe dafür können sehr unterschiedlich sein. Möglicherweise wurde der Begriff aus dem Umfeld übernommen, ohne zu wissen, dass es sich um einen diskriminierenden Begriff handelt. Selbstabwertende Selbstbezeichnungen können auch bewusst eingesetzt werden, um dem abwertenden Charakter entgegenzuwirken (Reclaiming). Übernehmen Sie solche Begriffe daher nur, wenn klar ist, mit welcher Absicht diese verwendet wurden. Markieren Sie diese Ausdrücke zudem unbedingt als Zitat der betreffenden Person.
- Menschen mit Behinderungen erleben oft, dass ihnen die Legitimität ihrer Schwierigkeiten und ihr Anspruch auf spezifische Dienstleistungen abgesprochen wird. Wenn beispielsweise Menschen mit Depressionen von ihren Erfahrungen berichten, sind Reaktionen wie «wir sind doch alle manchmal traurig oder ängstlich» oft tröstend und mitfühlend gemeint, können aber verletzend sein. Dasselbe gilt für ungefragte Ratschläge, wie man die Beeinträchtigung behandeln könnte. Für einen respektvollen Umgang mit Menschen mit Behinderungen ist es wichtig, dass man sie als vollwertige Gesprächspartner akzeptiert und somit auch direkt anspricht und anschaut. Vermeiden Sie es beispielsweise, eine Begleitperson nach den Wünschen und Bedürfnissen der Person mit Behinderungen zu fragen.
- Stellen Sie sich vor dem Schreiben oder Sprechen vor, wie Sie als Mensch mit all Ihren Eigenschaften dargestellt werden möchten. Auch Menschen mit Behinderungen haben nebst Ihren Behinderungen zahlreiche weitere Attribute und Eigenschaften. Es ist daher wichtig, dass auch andere Eigenschaften angesprochen werden, ohne dass diese unmittelbar mit der Behinderung in Zusammenhang stehen müssen. Überlegen Sie sich, inwiefern die Kategorie Behinderungen für Ihr Vorhaben von Bedeutung ist und ob diese überhaupt thematisiert werden soll. Wenn Sie beispielsweise ein Interview zum Thema Barrierefreiheit führen, dann sind Behinderungen ein wichtiger Faktor. Schreiben Sie jedoch über die Werke einer künstlerisch tätigen Person, welche Behinderungen hat, so sollte der Fokus auf den Werken liegen und die Behinderungen sind vielleicht gar nicht erwähnenswert.
Narrative
Die Berichte, die über Menschen mit Behinderungen verfasst werden, sind immer noch oft geprägt von einer stereotypen und einseitigen Sichtweise auf das Thema Behinderungen.
Die Rolle des «hilfsbedürftigen Opfers»
Vermeiden Sie eine Darstellungsweise, welche Menschen mit Behinderungen als hilfsbedürftige, leidende Wesen oder Opfer darstellt. Sie als hilfsbedürftig darzustellen, mag zwecks Generierung von Spendengeldern attraktiv erscheinen, entwürdigt sie aber auch und lässt ausser Acht, dass die Art und Weise der benötigten Hilfe genauso individuell ist, wie die Behinderungen selbst. Das Leben mit Behinderungen kann zwar schwierig sein, die Behinderungen selbst stellen aber nur einen Aspekt des Lebens dar. Die Reduktion des Lebens auf ein tragisches, sorgenvolles Dasein wirkt stigmatisierend und fördert die Angst vor Behinderungen. Behinderungen können auch Leiden verursachen. Bei der Darstellung des Leidens muss aber unterschieden werden, ob eine Problematik durch die Beeinträchtigung selbst (zum Beispiel Schmerzen) oder durch die Gesellschaft und eine nicht hindernisfreie Umwelt verursacht wird (zum Beispiel Einsamkeit, weil soziale Angebote nicht hindernisfrei zugänglich sind).
«Held*innen, die inspirieren»
Vermeiden Sie eine Darstellung, die Menschen mit Behinderungen als Heldinnen und Helden charakterisiert oder sie als Quelle der Inspiration verwendet. Menschen mit Behinderungen überwinden Hindernisse nicht trotz, sondern mit Behinderungen. Darstellungen von Helden*innen erwecken den Eindruck, dass für eine erfolgreiche Lebensführung allein der eigene Wille und die eigene Kraft ausschlaggebend ist. Dass Hindernisse im Alltag und gesellschaftliche Faktoren ebenfalls Teil der Behinderungen sind, rückt hierbei in den Hintergrund. Für Held*innen sind Hindernisse eine persönliche Herausforderung. Für die meisten Menschen mit Behinderungen sind Hindernisse aber vor allem Störfaktoren, welchen sie sich stellen müssen, ob sie wollen oder nicht.
| 🙂 | 🙁 |
| Mit Behinderungen leben, Behinderungen haben, von Behinderungen betroffen sein | An Behinderungen leiden, ein schweres Los tragen, ein trauriges Schicksal haben, tapfer und mutig sein Leben meistern, das Leben auf bewundernswerte Weise bewältigen |
| Mit Behinderungen | Trotz Behinderungen |
| Mensch mit Behinderungen, betroffene Person | Opfer, Schützling, hilfsbedürftiger Mensch |
| Mit Hindernissen umgehen | Hindernisse meistern |
Geeignete und ungeeignete Formulierungen
Viele Bezeichnungen und Ausdrücke umschreiben Menschen mit Behinderungen und ihre Lebenswelten. Im Folgenden werden einige problematische Formulierungen erläutert und Beispiele für eine diskriminierungsfreie Beschreibung genannt.
Gesund, krank, abnormal?
Als Mensch mit Behinderungen zu leben, bedeutet nicht automatisch krank zu sein. Wie alle Menschen, fühlen sich Personen mit Behinderungen krank, wenn sie Symptome und Beschwerden aufgrund einer Krankheit haben. Beschwerden können Teil von Behinderungen sein und die Betroffenen können sich aufgrund deren krank fühlen. Diese Beschwerden sind aber oft nicht konstant und können beispielsweise auch in Schüben auftreten. Die Grenzen zwischen sich gesund oder krank fühlen sind demnach fliessend. Somit sind Menschen mit Behinderungen nur dann Patient*innen, wenn sie medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Menschen mit Behinderungen werden oft «normalen» Personen gegenübergestellt. Auch wenn unbeabsichtigt, so impliziert dieser Begriff dennoch, dass Menschen mit Behinderungen «abnormal» sind.
|
🙂 |
🙁 |
|
Personen mit Behinderungen |
Kranke/abnormale/geschädigte Personen |
| Personen ohne Behinderungen | Gesunde/normale Personen |
| Mensch mit Behinderungen | Patientin/Patient (ausser im medizinischen Kontext) |
Subjekt statt Objekt?
Menschen mit Behinderungen werden immer wieder als Objekte statt als Subjekte wahrgenommen und behandelt. Damit wird ihnen eine passive Rolle zugeschrieben und die Eigenständigkeit abgesprochen. Besonders häufig geschieht dies im institutionellen Kontext, wenn Menschen mit Behinderungen als eine Problemstellung oder einen «Fall» bezeichnet werden. Auch der Begriff «invalid» ist abwertend. Zwar wird dieser von der IV verwendet und ist zur Bezifferung des Grades der Erwerbsfähigkeit zulässig. Eine Person als invalid zu charakterisieren, meint in den Wortsinnen jedoch, dass diese Person unfähig oder gar wertlos sei. Auch wenn Personen auf ihr Hilfsmittel reduziert werden, spricht man ihnen das Menschsein ab. Beispielsweise wenn «ein Rollstuhl die Strasse überquert». Menschen mit Behinderungen sind aktive Mitglieder Gesellschaft. Sie nehmen Dienstleistungen in Anspruch und verwenden Hilfsmittel. Sie sind aber nicht mit ihrer Fallnummer oder ihrem Hilfsmittel gleichzusetzen.
|
🙂 |
🙁 |
| Mensch mit Pflegebedarf, Antragsteller*in bei der IV, Mensch mit Leistungsanspruch,... | Pflegefall, IV-Fall |
| Mit Behinderungen | Invalid |
| Bewohner*in einer Wohngruppe oder einer Institution | Heiminsasse/Heiminsassin |
| Ein Mensch mit Rollstuhl überquert die Strasse | Ein Rollstuhl überquert die Strasse |
Annahmen über die Lebensrealität
Die eigene Vorstellung, wie sich eine bestimmte Lebensrealität anfühlen muss, entspricht nicht immer der Wahrheit. Für Menschen ohne Behinderungen kann es schwierig sein, sich in Personen mit bestimmten Behinderungen hineinzuversetzen. Auch wenn man glaubt, man könne die Situation des Gegenübers nachvollziehen, besteht die Möglichkeit, dass diese Vorstellung auf persönlichen Annahmen oder gängigen Stereotypen beruht. Beispielsweise bestehen Gebärdensprachen nicht nur aus einfachen aneinandergereihten Handzeichen. Auch empfinden Menschen mit Bewegungsbeeinträchtigungen ihren Rollstuhl oft nicht als etwas, was sie am Aufstehen hindert, sondern als Hilfsmittel, dass ihnen die Fortbewegung erleichtert.
|
🙂 |
🙁 |
| Mit dem Rollstuhl unterwegs sein, einen Rollstuhl benutzen | An den Rollstuhl gefesselt sein |
| Als blinde Person keinen Sehrest haben | Als blinde Person im dunkeln Leben |
| Eine körperliche Beeinträchtigung haben | Im Körper gefangen sein |
| Gebärdensprache | Zeichensprache |
Barrieren oder Hindernisse?
Die Meinungen gehen auseinander, inwiefern sich diese beiden Begriffe ganz klar unterscheiden oder abgrenzen lassen. Tendenziell wird Hindernisfreiheit für die räumliche Umwelt verwendet. Bei der digitalen Kommunikation spricht man hingegen von “Barrierefreier Online-Kommunikation". In vielen anderen Lebensbereichen können «Hindernisfreiheit» und «Barrierefreiheit» synonym verwendet werden.
Barrierefreie Kommunikation
Zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen gehört nicht nur, dass diskriminierungsfrei gesprochen und geschrieben wird, sondern auch, dass diese Informationen für alle Menschen barrierefrei zugänglich sind. Grundsätzlich gilt: Verwenden Sie eine möglichst einfache Sprache. Vermeiden Sie komplizierte Fachbegriffe und formulieren Sie kurze Sätze. Längere Texte sind zudem einfacher zu verstehen, wenn sie in Abschnitte gegliedert sind.
Die «Leichte Sprache» ist eine Form der einfachen Sprache, die bestimmten Regeln und Strukturen folgt. Sie dient insbesondere Menschen mit Lese- oder Verständnisschwierigkeiten Informationen leichter aufzunehmen und zu verarbeiten. Die Leichte Sprache setzt Fachkenntnisse voraus, weshalb Texte von Fachpersonen übersetzt werden müssen und von der Zielgruppe überprüft werden sollten.
Auch Menschen mit Behinderungen schätzen oft eine inklusive Sprache, welche gendergerecht formuliert ist. Besonders geeignet sind geschlechtsneutrale Begriffe, wie etwa «Lehrperson». Diese Bezeichnungen sind leicht verständlich, einfach zu handhaben und schliessen alle Geschlechter mit ein. Einfache geschlechtsneutrale Begriffe eignen sich auch für die Verwendung in Leichter Sprache. Das Gendern mit Partizipien (z.B. «Autofahrende», «Zuhörende») kann ungewohnte Satzstrukturen hervorrufen und wird oft von Menschen, die auf Leichte Sprache angewiesen sind, nicht verstanden. Partizipien sollten deshalb nur verwendet werden, wenn sie weit verbreitet sind. Auch die Verwendung von Genderzeichen, wie beispielsweise des Gendersterns ist möglich, wenn erklärt wird, was das gewählte Zeichen bedeutet und wofür es steht. Von den Genderzeichen wird der Genderstern am besten von Menschen mit Behinderungen verstanden, da er vielen bereits bekannt ist. Auch Menschen mit Sehbehinderungen, die sich Text vorlesen lassen, ist der Genderstern besser geeignet als andere Symbole, wie etwa der Doppelpunkt.
Weiter ist zu beachten, dass die Inhalte digital verfügbar sein sollten. Am besten ist es, wenn sie direkt auf einer barrierefreien Webseite integriert sind, denn das Erstellen barrierefreier PDFs ist nicht immer einfach und erfordert teilweise erweiterte Kenntnisse. Fotos sollten immer mit einem Alternativtext oder einer Bildbeschreibung versehen werden. Wichtig ist auch eine inklusive Bildsprache. Dies bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen auf Bildern als Teil der Gesellschaft in Erscheinung treten. Da es viele unsichtbare Behinderungen gibt, bedeutet dies aber nicht, dass beim Schreiben über Menschen mit Behinderungen immer Menschen mit sichtbaren Behinderungen gezeigt werden müssen.
Quellen und weiterführende Links
- Agile.ch: Sprache ist verräterisch. Tipps für eine respektvolle Sprache, die Menschen mit Behinderungen nicht diskriminiert und entwertet.
- Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG)
- Ebner, Christopher: Leicht Verständliche Sprache genderfair! Studie zur Verwendung genderfairer Sprache in leicht verständlicher Sprache, Graz 2023.
- Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen EBGB: Schreiben zum Thema Behinderungen – Tipps für Medienschaffende.
- Fachstelle für die Gleichstellung von Frau und Mann der Stadt Bern: Sprachleitfaden Kommunikation und Geschlecht.
- Kompetenzzetrum Migration der Stadt Bern: Diskriminierungsfreie Kommunikation.
- Leidmedien.de – Disability Mainstreaming in Gesellschaft und Medien
- MyPAR.ch – Agentur für Barrierefreiheit
- Stiftung Zugang für Alle – Kompetenzzentrum für digitale Barrierefreiheit
- Übereinkommen der UNO über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN BRK)